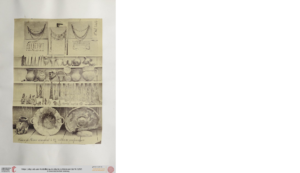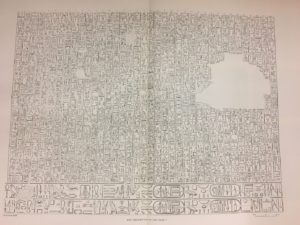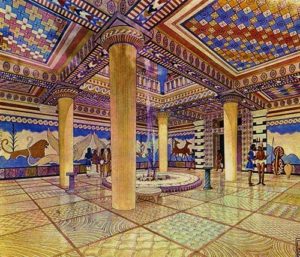Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Plutarch
Lizenz: CC-BY-NC-SA
Plut. Aem. 20.1 – 20.5, 21.3 – Original:
20 [1] τῶν δὲ Ῥωμαίων, ὡς ἀντέστησαν τῇ φάλαγγι, μὴ δυναμένων βιάζεσθαι, Σάλουιος ὁ τῶν Πελιγνῶν ἡγούμενος ἁρπάσας τὸ σημεῖον τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν εἰς τοὺς πολεμίους ἔρριψε. τῶν δὲ Πελιγνῶν οὐ γάρ ἐστιν Ἰταλοῖς θεμιτὸν οὐδ᾽ ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν σημεῖον ἐπιδραμόντων πρὸς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἔργα δεινὰ καὶ πάθη παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀπήντα συμπεσόντων. [2] οἱ μὲν γὰρ ἐκκρούειν τε τοῖς ξίφεσι τὰς σαρίσας ἐπειρῶντο καὶ πιέζειν τοῖς θυρεοῖς καὶ ταῖς χερσὶν αὐταῖς ἀντιλαμβανόμενοι παραφέρειν, οἱ δὲ τὴν προβολὴν κρατυνάμενοι δι᾽ ἀμφοτέρων καὶ τοὺς προσπίπτοντας αὐτοῖς ὅπλοις διελαύνοντες, οὔτε θυρεοῦ στέγοντος οὔτε θώρακος τὴν βίαν τῆς σαρίσης, ἀνερρίπτουν ὑπὲρ κεφαλὴν τὰ σώματα τῶν Πελιγνῶν καὶ Μαρρουκινῶν, κατ᾽ οὐδένα λογισμὸν, ἀλλὰ θυμῷ θηριώδει, πρὸς ἐναντίας πληγὰς καὶ προὖπτον ὠθουμένων θάνατον. [3] οὕτω δὲ τῶν προμάχων διαφθαρέντων ἀνεκόπησαν οἱ κατόπιν αὐτῶν ἐπιτεταγμένοι: καὶ φυγὴ μὲν οὐκ ἦν, ἀναχώρησις δὲ πρὸς ὄρος τὸ καλούμενον Ὀλόκρον, ὥστε καὶ τὸν Αἰμίλιον ἰδόντα φησὶν ὁ Ποσειδώνιος καταρρήξασθαι τὸν χιτῶνα, τούτων μὲν ἐνδιδόντων, τῶν δ᾽ ἄλλων Ῥωμαίων διατρεπομένων τὴν φάλαγγα προσβολὴν οὐκ ἔχουσαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ χαρακώματι τῷ πυκνώματι τῶν σαρισῶν ὑπαντιάζουσαν πάντοθεν ἀπρόσμαχον. [4] ἐπεὶ δὲ τῶν τε χωρίων ἀνωμάλων ὄντων, καὶ διὰ τὸ μῆκος τῆς παρατάξεως οὐ φυλαττούσης ἀραρότα τὸν συνασπισμόν, κατεῖδε τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων κλάσεις τε πολλὰς καὶ διασπάσματα λαμβάνουσαν, ὡς εἰκὸς ἐν μεγάλοις στρατοῖς καὶ ποικίλαις ὁρμαῖς τῶν μαχομένων, τοῖς μὲν ἐκθλιβομένην μέρεσι, τοῖς δὲ προπίπτουσαν, ἐπιὼν ὀξέως καὶ διαιρῶν τὰς σπείρας ἐκέλευεν εἰς τὰ διαλείμματα καὶ κενώματα τῆς τῶν πολεμίων τάξεως παρεμπίπτοντας καὶ συμπλεκομένους μὴ μίαν πρὸς ἅπαντας, ἀλλὰ πολλὰς καὶ μεμιγμένας κατά μέρος τὰς μάχας τίθεσθαι. [5] ταῦτα τοῦ μὲν Αἰμιλίου τοὺς ἡγεμόνας, τῶν δ᾽ ἡγεμόνων τοὺς στρατιώτας διδασκόντων, ὡς πρῶτον ὑπέδυσαν καὶ διέσχον εἴσω τῶν ὅπλων, τοῖς μὲν ἐκ πλαγίου κατὰ γυμνὰ προσφερόμενοι, τοὺς δὲ ταῖς περιδρομαῖς ἀπολαμβάνοντες, ἡ μὲν ἰσχὺς καὶ τὸ κοινὸν ἔργον εὐθὺς ἀπωλώλει τῆς φάλαγγος ἀναρρηγνυμένης, ἐν δὲ ταῖς καθ᾽ ἕνα καὶ κατ᾽ ὀλίγους συστάσεσιν οἱ Μακεδόνες μικροῖς μὲν ἐγχειριδίοις στερεοὺς καὶ ποδήρεις θυρεοὺς νύσσοντες, [p. 410] ἐλαφροῖς δὲ πελταρίοις πρὸς τὰς ἐκείνων μαχαίρας ὑπὸ βάρους καὶ καταφορᾶς διὰ παντὸς ὅπλου χωρούσας ἐπὶ τὰ σώματα, κακῶς ἀντέχοντες ἐτράποντο, […] 21 [3] καὶ τέλος οἱ τρισχίλιοι λογάδες ἐν τάξει μένοντες καὶ μαχόμενοι κατεκόπησαν ἅπαντες: τῶν δ᾽ ἄλλων φευγόντων πολὺς ἦν ὁ φόνος, ὥστε τὸ μὲν πεδίον καὶ τὴν ὑπώρειαν καταπεπλῆσθαι νεκρῶν, τοῦ δὲ Λεύκου ποταμοῦ τὸ ῥεῦμα τοὺς Ῥωμαίους τῇ μετὰ τὴν μάχην ἡμέρᾳ διελθεῖν ἔτι μεμιγμένον αἵματι. [p. 412] λέγονται γὰρ ὑπὲρ δισμυρίους πεντακισχιλίους ἀποθανεῖν. τῶν δὲ Ῥωμαίων ἔπεσον, ὡς μὲν Ποσειδώνιός φησιν, ἑκατόν, ὡς δὲ Νασικᾶς, ὀγδοήκοντα.
Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Bernadotte Perrin
Lizenz: CC-BY-NC-SA
Übersetzung:
20 [1] The Romans, when they attacked the Macedonian phalanx, were unable to force a passage, and Salvius, the commander of the Pelignians, snatched the standard of his company and hurled it in among the enemy. Then the Pelignians, since among the Italians it is an unnatural and flagrant thing to abandon a standard, rushed on towards the place where it was, and dreadful losses were inflicted and suffered on both sides. [2] For the Romans tried to thrust aside the long spears of their enemies with their swords, or to crowd them back with their shields, or to seize and put them by with their very hands; while the Macedonians, holding them firmly advanced with both hands, and piercing those who fell upon them, armour and all, since neither shield nor breastplate could resist the force of the Macedonian long spear, hurled headlong back the Pelignians and Marrucinians, who, with no consideration but with animal fury rushed upon the strokes that met them, and a certain death. [3] When the first line had thus been cut to pieces, those arrayed behind them were beaten back; and though there was no flight, still they retired towards the mountain called Olocrus, so that even Aemilius, as Poseidonius tells us, when he saw it, rent his garments. For this part of his army was retreating, and the rest of the Romans were turning aside from the phalanx, which gave them no access to it, but confronted them as it were with a dense barricade of long spears, and was everywhere unassailable. [4] But the ground was uneven, and the line of battle so long that shields could not be kept continuously locked together, and Aemilius therefore saw that the Macedonian phalanx was getting many clefts and intervals in it, as is natural when armies are large and the efforts of the combatants are diversified; portions of it were hard pressed, and other portions were dashing forward. Thereupon he came up swiftly; and dividing up his cohorts, ordered them to plunge quickly into the interstices and empty spaces in the enemy’s line and thus come to close quarters, not fighting a single battle against them all, but many separate and successive battles. [5] These instructions being given by Aemilius to his officers, and by his officers to the soldiers, as soon as they got between the ranks of the enemy and separated them, they attacked some of them in the flank where their armour did not shield them, and cut off others by falling upon their rear, and the strength and general efficiency of the phalanx was lost when it was thus broken up; and now that the Macedonians engaged man to man or in small detachments, they could only hack with their small daggers against the firm and long shields of the Romans, and oppose light wicker targets to their swords, which, such was their weight and momentum, penetrated through all their armour to their bodies. They therefore made a poor resistance and at last were routed. […] 21 [3] Finally, the three thousand picked men of the Macedonians, who remained in order and kept on fighting, were all cut to pieces; and of the rest, who took to flight, the slaughter was great, so that the plain and the lower slopes of the hills were covered with dead bodies, and the waters of the river Leucus were still mingled with blood when the Romans crossed it on the day after the battle. For it is said that over twenty-five thousand of their enemies were slain; while of the Romans there fell, according to Poseidonius, a hundred, according to Nasica, eighty.
Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Agnes von der Decken
Lizenz: CC-BY-NC-SA
Plut. Aem. 20.1 – 20.5, 21.3
Leitfragen:
1) Geben Sie den Schlachtverlauf wieder.
2) Wie gelingt es den Römern, die Makedonen zu schlagen?
3) Welche Folgen hatte die Niederlage der Makedonen?
Kommentar:
In der obigen Quellenstelle, einem Auszug aus der Aemilius-Vita des Plutarch, geht es um die Schlacht von Pydna im sogenannten Dritten Makedonisch-Römischen Krieg. In dieser standen sich die makedonischen Streitkräfte unter König Perseus und die römischen Legionen unter Feldherr Lucius Aemilius Paulus gegenüber. Zum Krieg kam es, weil die Römer fürchteten, dass das unter Philip V und dann Perseus wieder erstarkte Makedonien (durch eine Reorganisation im Inneren nach der Niederlage im Zweiten Makedonisch-Römischen Krieg erholten sich die Makedonen in ökonomischer wie demographischer Hinsicht, was eine offensive Politik wieder möglich machte) ihnen die politische Kontrolle über Griechenland streitig machen könnte. Sie forcierten deswegen einen Krieg gegen die Makedonen.
In der obigen Quellenpassage beschreibt Plutarch die Abläufe dieser für die Makedonen vernichtenden Schlacht beim griechischen Pydna. Hier heißt es, dass die Römer anfangs vergeblich versucht hätten, die Phalanx der Makedonen mit ihren Schwertern zu durchbrechen. Da sich die Makedonen jedoch in ihrer Phalanx verschanzt und gleichzeitig die anlaufenden römischen Soldaten mit ihren Lanzen durchbohrt hätten, hätte der römische Feldherr Aemilius seinen Soldaten befohlen, in die Lücken und Öffnungen der feindlichen Schlachtreihen einzudringen. Denn durch das unebene Gelände hätte die makedonische Phalanx den Zusammenschluss der Schilde nicht durchgängig wahren können. So sei es den Römern gelungen, sich in die feindlichen Reihen einzuschieben und die Makedonen in Einzelkämpfen in die Flucht zu schlagen. Plutarch berichtet, dass die Römer die Makedonen auf diese Weise bis auf den letzten Mann niedergehauen hätten. Die Ebene sei daraufhin mit Leichen bedeckt und der Fluss vom Blut der Toten gefärbt gewesen. Auf makedonischer Seite hätten über 25.000 Männer den Tod gefunden, auf römischer Seite hingegen nur hundert oder achtzig.
Plutarch liefert in seiner Beschreibung der Schlacht von Pydna mehrere Gründe dafür, warum die Römer die Makedonen besiegen konnten. So gelang es den Römern laut Plutarch anfangs nicht, die Phalanx der Gegner anzugreifen. Der römische Feldherr Aemilius hätte dies jedoch erkannt und unvermittelt darauf reagiert, indem er eine neue Kampftaktik anwendete: Er hätte seine Soldaten in kleinere Abteilungen eingeteilt und ihnen befohlen, in die Lücken der gegnerischen Phalanx einzudringen. Dies sei gelungen, weil die makedonische Phalanx aufgrund ihrer Größe auf dem unebenen Gelände ihre Formation – Schild an Schild – nicht hätte halten können. Durch das Eindringen der Römer in die Schlachtenreihen der Gegner sei die Phalanx auseinandergerissen und somit ihrer Wucht beraubt worden. Im Einzelgefecht hätten die Makedonen sodann keine Chance mehr gehabt, da ihre kurzen Schwerter und Schilde nicht gegen die Größe der Schwerter und Schilde der Römer angekommen seien. Laut Plutarch führten demnach Aemiliusʼ taktisches Gespür, das unebene Gelände, das Auflösen der Phalanxformation sowie die Überlegenheit der römischen Waffen zum vernichtenden Sieg der Römer über die Makedonen. In der Beschreibung der Schlacht von Pydna zeigt sich damit grundsätzlich die Überlegenheit der flexiblen römischen Legionen gegenüber der starren makedonischen Phalanxformation.
Bei der Schlacht von Pydna sollen mehr als 20.000 Makedonen umgekommen sein. Der geschlagene Perseus wurde von Aemilius Paullus in einem Triumphzug in Rom mitgeführt und anschließend in Haft gehalten, bis er starb. Der römische Sieg in Pydna bedeutete schlussendlich den Untergang Makedoniens. Die siegreichen Römer, die zunehmend dazu neigten, politische Gegner zu bestrafen und auszuschalten, schafften die antigonidische Monarchie in Makedonien daraufhin endgültig ab, womit die staatlichen Strukturen Makedoniens zerstört wurden. Das Gebilde eines vereinigten makedonischen Staates, das einst unter Philipp II. entstand, wurde von den Römern völlig zerschlagen. Stattdessen installierten die Römer vier makedonische Republiken, die wirtschaftlich wie militärisch unterdrückt wurden. Sogar soziale Kontakte, etwa Ehen zwischen Mitgliedern der einzelnen Republiken, waren untersagt. Makedonien als Staat verschwand endgültig. Die Makedonen waren auf diesem Wege Untertanen Roms geworden und ihre weiteren Geschicke wurden nun von Rom bestimmt.
Vergleichen Sie zu hierzu auch die Beiträge zur Schlacht von Kynoskephalai, zur Freiheitsdeklamation des Titus Q. Flaminius und zu Thukydides über die Phalanx.